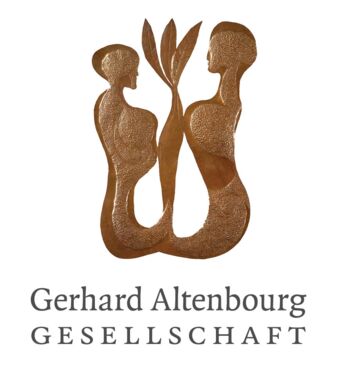Gerhard Altenbourg
Schon vor Jahren fiel er mir auf. Ein eigenartig versponnener Zeichner und Maler. Seine Arbeiten blieben bei uns im Süden Deutschlands so gut wie unbekannt. In Lithos, Holzschnitten, Aquarellen, Handzeichnungen mit Feder, Blei, Rötel, chinesischer Tusche, Kreide hat er sein Bestes gegeben: bald sublim umgesetzte Landschaften, bald riesige Blätter, die in skurriler, höchst phantastischer Weise den Menschenkörper verfremden. Im Grunde aber blieb er immer ein verwegener Traumlyriker, gelegentlich auch dichtend. Alles wird ihm zum Phantom, das er in weithin schweifenden Haupt- und tausendfältigen Nebenlinien verwirklicht. Meist wird die Fläche für ihn zu einem geheimen Netz, in das sich an- und abbrechende, breite und zaghafte, kühne und scheue, gegenständliche und abstrakt wirkende Verläufe einhängen. Man muß sich sehr genau ansehen, was in den „Hintergründen“ alles krabbelt, raschelt, wiebelt. Auch in unseren Blättern (es gibt viel gegenständlichere!) wimmeln Mikroerinnerungen an Landschaften mit Wegen, Flußläufen und pianissimo gehaltenen „Lebewesen“. Alles mit minutiösem Fleiße durchgehalten, ohne daß die Umsetzung, der Traumcharakter irgendwo verlorenginge. Altenbourgs Fakturenphantasie ist hoch entwickelt. Wo er als „Illustrator“ fungiert, meint er niemals ein äußeres Nachbilden.
In kleiner Auflage erschien „Altenbourg 1958“, „Tatauierte Litaneien“ 1962, „Vier Gedichte von Theodor Däubler“ 1963. Als Unikate „Dolce et decorum“, „Salutation“, „Oh Janus, oh Janus“, „Mechulle“, „In den Hebrosfluß hinab“ 1963.
Er stammt aus dem Thüringer Wald, ein Pfarrerssohn, 1926 geboren. Ausgestellt wurden seine Arbeiten zuerst von der Galerie Springer, Berlin (1952, 1956, 1961, 1964), bei Dr. Mock, München, auf der Documenta, in Baden-Baden, in Mannheim und bei der „Gesellschaft der Freunde junger Kunst“ in München.
Franz Roh: Gerhard Altenbourg. In: Die Kunst und das schöne Heim, Jg. 63, 1965, Heft 4. Abbildungen: L 43 Lebensbaum, 1950, 61/10 Geburt, 63/9 Und dann war es ein großer Berg, 63/15 In den Wassern der Nacht.